Am 2. November ist Allerseelen. Es ist Tradition, an diesem Tag den Verstorbenen zu gedenken. Den Rest des Jahres jedoch wird kaum ein Thema so gemieden wie Sterben, Tod und Trauer. Dabei kann es jederzeit topaktuell werden.
Genuss, Geselligkeit und Wohlgefühl – das Gastgewerbe ist eine Branche, in der die schönen Seiten des Lebens zelebriert werden. Doch selbst hier gibt es tragische Momente. Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein Familienmitglied verliert oder selber stirbt.
Ein Todesfall ist wie ein Erdbeben. Es schüttelt die Hinterbliebenen durch und zieht ihnen den Boden unter den Füssen weg. Halt geht verloren, emotionale, organisatorische oder auch finanzielle Abgründe tun sich auf. Und noch bevor man sein Gleichgewicht wiedergefunden hat, muss man die vielen administrativen Aufgaben und emotionalen Herausforderungen bewältigen, die auf einen niederprasseln.
Selbst wenn sich der Todesfall im Privatleben eines Mitarbeitenden ereignet hat, geht das Ereignis nicht spurlos am Arbeitsplatz vorbei. Sei es, weil die Arbeitsleistung und -weise der trauernden Person nachgelassen hat oder weil der Todesfall bei den Teamkollegen Betroffenheit auslöst und Anpassungen der Betriebsabläufe und Arbeitspläne nötig macht.
Vielen fällt der Umgang mit einem trauernden Teammitglied schwer. Soll man dessen Verlust ansprechen? Und wenn ja, wie? Was, wenn die Trauer länger anhält? Antworten auf solche Fragen gibt die Broschüre «Trauer in der Arbeitswelt». Sie kann online gratis bei travailsuisse.ch (Suchbegriff Trauer) heruntergeladen werden.
Die Broschüre gibt gute Tipps, macht aber auch klar: Es gibt kein allgemeingültiges Trauerbewältigungs-Szenario. Wie intensiv und wie lange jemand Trauer erlebt, wie er mit ihr umgeht und sie verarbeitet, ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Es braucht daher vom Umfeld viel Fingerspitzengefühl und Verständnis. Umso mehr, da der Trauerprozess – von Nicht-Wahrhaben-Wollen über Akzeptanz bis zum Neuausrichten des eigenen Lebens – nicht linear, sondern mit etlichen Wendungen, Umwegen und Kehrschlaufen verlaufen kann.
Dennoch lohnt es sich, trauernde Mitarbeitende nicht fallenzulassen. Ein gemeinsam durchgestandener Trauerprozess verbindet ungemein. Und er führt meist zu einer Stärkung des Zusammenhalts und zu vertrauensvollen, wertschätzenden, loyalen und langjährigen Arbeitsbeziehungen. Etwas, das in der heutigen Zeit der kurzen Verweildauer im Betrieb und des Fachkräftemangels besonders wertvoll ist.

Wie sich bei der Recherche für diesen Artikel herausstellte, wird bei Todesfällen im Mitarbeiterstab von Hotels oft sehr spontan und situativ, dadurch aber auch etwas unstrukturiert agiert.
Es gibt auch Hotels, die eine Trauerkultur etabliert haben. So wie ein grösserer Betrieb in der Deutschschweiz, der nicht namentlich erwähnt sein möchte. Hier gibt es klare Richtlinien, wie im Todesfall von Mitarbeitenden oder deren Angehörigen vorgegangen wird und welche Art der Unterstützung die jeweils betroffenen Personenkreise erhalten. Es ist unter anderem festgelegt, wer – Teamleiter, Personalchef oder Geschäftsführer – eine Kondolenzkarte schreibt und wer, falls das von der Trauerfamilie gewünscht wird, den Betrieb an der Abdankungsfeier repräsentiert.
Der Tod von Mitarbeitenden wird mit einer Würdigung der verstorbenen Person über die interne Kommunikations-App allen Angestellten mitgeteilt. Wer möchte, kann auf dieser App seine Betroffenheit ausdrücken oder Erinnerungen teilen. Die App wird auch genutzt, um sich gegenseitig Trost zuzusprechen. Zudem wird jeweils am nächsten Mitarbeiterinfoanlass an das verstorbene Teammitglied erinnert. Dort hat man nochmals die Gelegenheit, gemeinsame Erlebnisse und Anekdoten auszutauschen, bevor die verstorbene Person mit einer Schweigeminute verabschiedet wird. Bei Bedarf erhält das Team des Verstorbenen Unterstützung bei der Trauerverarbeitung. Auch die Kommunikation nach aussen ist geregelt. Es gibt Kriterien, wessen Tod in welcher Form (Karte, Mail, Newsletter, Zeitungsinserat) den Gästen, den Lieferanten und anderen Geschäftspartnern oder der breiten Öffentlichkeit kommuniziert wird.
Ein Buch, das hilft, Arbeiten in Zusammenhang mit einem Todesfall schneller zu erledigen, damit mehr Zeit für die Trauer bleibt, ist der «Trauer-Knigge» von Zita Langenstein und Anja Niederhauser (siehe Buchtipp).
Stirbt im Umfeld jemand, führt das unweigerlich dazu, dass einem auch die eigene Endlichkeit bewusst wird. Dementsprechend sinniert die Comic-Figur Charlie Brown: «Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy.» Der antwortet: «Stimmt. Aber an allen anderen Tagen leben wir.»
(Riccarda Frei)
Quellen: travail.suisse.ch und L-GAV des Gastgewerbes (Art. 20) und GAV für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche (Art. 24)
Am wichtigsten ist, dass man einer trauernden Person nicht ausweicht. Wer in Trauer ist, hat bereits einen grossen Verlust erlitten und fühlt sich alleine. Er oder sie soll nun nicht auch noch Ausgrenzung und den Entzug von sozialen Kontakten erleben müssen. Fehlen einem die Worte, kann man das benennen: «Ich habe von deinem Verlust gehört und weiss nicht, was ich sagen soll.» Man kann anbieten, gemeinsam, gerne auch schweigend, ein paar Schritte zu gehen, oder einen Kaffee zu trinken. Je nach Vertrautheit kann man auch eine Umarmung anbieten. Es geht einfach darum zu signalisieren: Du bist nicht allein.
Trauer ist etwas ganz Individuelles. Darum sollte man den Trauernden keine Ratschläge erteilen. Es gibt auch viele Floskeln, die wenig hilfreich sind. «Jetzt ist sie erlöst» oder «Er ist jetzt an einem besseren Ort» verharmlosen den Schmerz. Sie führen dazu, dass der Trauernde sich nicht wahrgenommen fühlt. Auch sollte vermieden werden, Trauernden zu sagen, wie lange sie trauern dürfen. Ein Trauerprozess dauert so lange, wie er eben dauert.
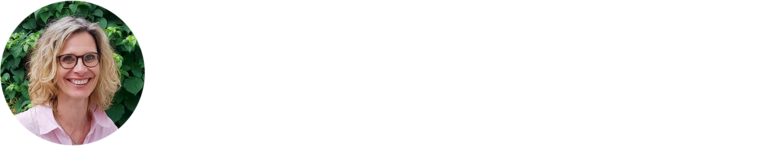
Simone Kuhn ist Sterbe- und Trauerbegleiterin.
Trauer ist eine natürliche, gesunde Reaktion auf einen Verlust. Sie hilft uns, mit der entstandenen Lücke umzugehen und im Leben wieder Fuss zu fassen. Trauer ist quasi der Baustoff für die Brücke zwischen dem Leben, das sich unwiderruflich verändert hat, und dem neuen Leben, das es nun aufzubauen gilt. Wird Trauer nicht zugelassen, können körperliche und psychische Beschwerden auftreten. Im Trauerprozess geht es nicht primär um aktives Tun. Es geht mehr um das Wahrnehmen der Gefühle, um das Erinnern, um das Schaffen innerlicher Ordnung und das Bewusstwerden der eigenen Ressourcen, damit nach und nach Schritte in ein wieder freudvolles Leben möglich sind.
Ja, die gibt es. Der Tod eines geliebten Menschen ist aber für alle eine Erschütterung. Frauen zeigen nach dem ersten Schock in der Regel rasch Emotionen und reden über ihren Verlust. Männer hingegen fallen eher in eine Art Starre. Sie ignorieren und unterdrücken ihre Gefühle, was langfristig zu massiven körperlichen Beschwerden führen kann.
Sie können dem trauernden Mitarbeitenden Raum für ein Gespräch und ein offenes Ohr geben. Das ist immer hilfreich. Frauen nehmen dieses Angebot oft gerne an. Für einen männlichen Kollegen in Trauer kann es unterstützend sein, ihn zum gemeinsamen Sport oder einer anderen körperlichen Betätigung einzuladen. Über die körperliche Aktivität finden Männer oft eher den Zugang zu ihren Gefühlen und können diese dann auch verbal leichter ausdrücken. Unabhängig von Geschlecht und kulturellem Hintergrund von Trauernden: Die Führungskräfte sollten den Mut haben, die trauernde Person direkt zu fragen, was sie braucht und wie man sie unterstützen kann.
Sich stärker mit dem Thema Tod und Trauer befassen. Es braucht in den Betrieben Notfallpläne für Todesfälle. Diese enthalten unter anderem Informationen, welche Massnahmen getroffen werden, wer wofür zuständig ist und wie man intern sowie extern mit einem Todesfall umgeht. Viele Führungskräfte wissen wenig über Trauerprozesse. Eine hilfreiche Trauerkultur hat viel mit Haltung zu tun. Wer seine Angestellten bei Trauerprozessen unterstützt, wird mit loyalen Mitarbeitenden sowie einem gestärkten Team belohnt. Allerdings muss klar sein: Kein Betrieb kann die Verantwortung für den individuellen Prozess des Trauernden übernehmen. Aber jeder Betrieb kann viel Gutes tun, damit dieser individuelle Prozess möglich wird.
Es gibt Trauernde, die entweder niemanden haben, der sie wertschätzend, empathisch und mit offener Kommunikation begleitet, oder die ihre Angehörigen und Freunde nicht mit ihrer Trauer und ihren teils heftigen Emotionen belasten möchten. In solchen Fällen ist eine professionelle Trauerbegleitung sinnvoll. Eine Trauerbegleiterin ist eine neutrale Person, mit der Trauernde ohne Scham und Scheu reden können, die von aussen auf die Situation blickt und ihnen hilft, sich ihrer Ressourcen und Möglichkeiten bewusst zu werden. Betrieben können professionelle Trauerbegleiterinnen beim Etablieren einer Trauerkultur helfen. Tritt der Fall der Fälle ein, können sie Betriebe wertvoll im internen Prozess unterstützen und Führungskräfte entlasten, indem sie die Begleitung von trauernden oder vom Todesfall betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernehmen.